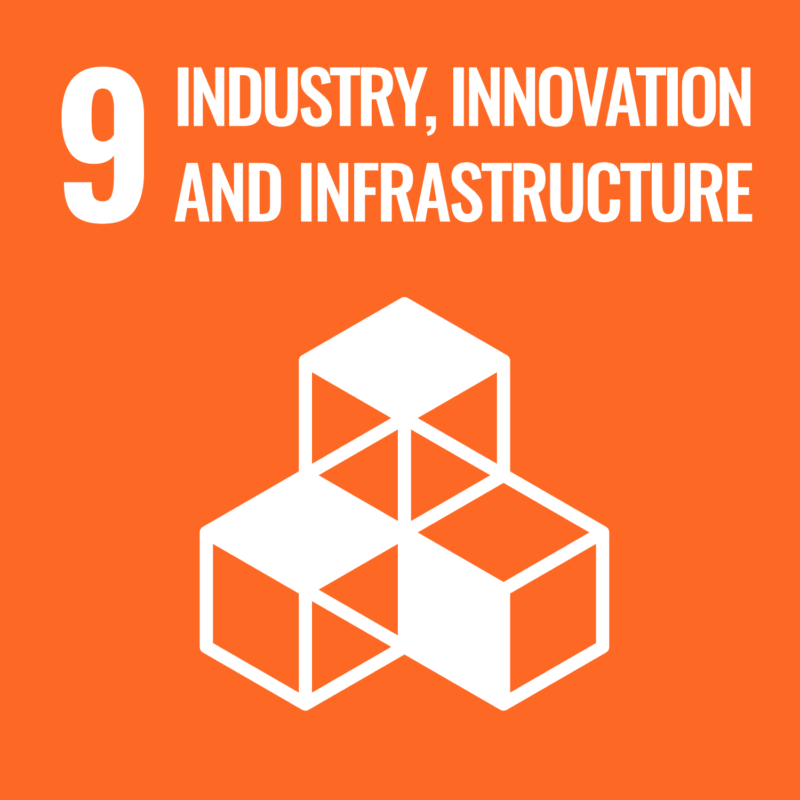Das Forschungsprojekt „MoFIDES“ (Modulare Filterdesinfektion und Dekontamination), unter der Leitung von FOTEC, erfolgt in Kooperation mit RHP Attophotonics, dem OFI Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik und dem Bundesministerium für Landesverteidigung.
Das Projekt wird im Rahmen des österreichischen Verteidigungsforschungsprogramms FORTE durchgeführt, finanziert durch das Bundesministerium für Finanzen und wird von der FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH verwaltet.
Ziel des Projekts ist es, Technologien zu entwickeln, die eine chemische und/oder physikalische Desinfektion und Dekontamination von Luftfiltermodulen für den kollektiven CBRN-Schutz während des Betriebs ermöglichen, um die maximale Betriebszeit der Filter zu verlängern. Unter anderem wird die dekontaminierende Wirkung von UV-LED-Bestrahlung und die Effizienz der eingesetzten UV-LED-Modulen auch in Kombination mit UV-aktiver photokatalytischer Beschichtung mit mikrobiologischen Methoden wissenschaftlich untersucht. Dazu werden statische und strömende Untersuchungen im Labor mit bis zu fünf Surrogaten für biologische Kampfstoffe (Bakterien, Schimmelpilze, Sporen, Viren) durchgeführt.
Luftfiltermodule als Schutz gegen ABC-Bedrohungen
Als CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) oder ABC-Schutz bezeichnet man den Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren und Waffen. Dies umfasst sowohl den Schutz von Soldat*innen vor Bedrohungen in Kriegsszenarien als auch die Katastrophenhilfe im In- und Ausland. Die ABC-Ausrüstung wird zum Aufspüren gefährlicher Stoffe, die Dekontaminierung (Entstrahlen, Entseuchen und Entgiften) von Personen, Geräten und Gebieten sowie für die Rettung von Menschen aus zerstörten und kontaminierten Objekten eingesetzt.
Luftfiltermodule, die für den kollektiven Schutz gegen ABC-Bedrohungen eingesetzt werden, beinhalten typischerweise einen Faserfilter (zur Rückhaltung von partikulären Schadstoffen v.a. Stäuben und mikrobiellen Erregern) und einen Aktivkohlefilter (zur Adsorption oder Oberflächen-Bindung von gasförmigen Schadstoffen insbesondere chemischen Kampfstoffen). Beide Filter verfügen über eine maximale Aufnahmekapazität. Ist diese erreicht, steigt der Luftwiderstand des Filtermoduls. Das bedeutet, der angrenzende Innenraum wird mit zu wenig Frischluft versorgt und/oder es kommt zu einem Filterdurchbruch und Kampfstoff gelangt ins Innere. Die Filterkapazität bestimmt also die maximale Einsatzzeit bevor ein Tausch des Filters erforderlich ist.
Der Tausch eines ABC-Schutzfilters, v.a. nachdem er einem Kampfstoff ausgesetzt wurde, schränkt die Nutzung des vom Filter geschützten Raumes (z.B. Fahrzeug) ein, birgt immer ein Gefahrenpotential und verursacht einen personellen sowie logistischen Aufwand, der je nach Einsatzgebiet teilweise erheblich ist. Vor allem im mobilen Einsatz sind Nutzer*innen von ABC-Schutzfiltern daher besonders daran interessiert, die maximale Einsatzzeit zu verlängern. Hierfür müssten allerdings gebundene Schadstoffe im Betrieb (in situ) zersetzt und/oder jedenfalls desorbiert werden, was auch die Gefährlichkeit der Filter beim Ausbau senken würde, derzeit aber technisch nicht möglich ist.
Im gegenständlichen Projekt werden Technologien entwickelt, die genau dies erlauben und dabei die Eigenschaften der beiden sehr unterschiedlichen Komponenten von ABC-Filtern (Faserfilter & Aktivkohle) berücksichtigen (d.h. optische Dichte, Geometrie, Wirkungsprinzip, erwartbare Schadstoffbelegung). Aufgrund ihrer hohen technischen Flexibilität sollen UV-LEDs für die Dekontamination von Faserfiltern über direkte Wirkung (antimikrobielle Wellenlängen) oder indirekt über die photokatalytische Erzeugung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) untersucht werden.
Im Bereich der Aktivkohle-Dekontamination wird sich das Projekt auf die thermisch-chemische, In-situ-Dekontamination bzw. -Desorption konzentrieren. Ziel des Projekts ist, im Labormaßstab eine Datenbasis darüber zu erarbeiten, welche Technologien sich für die In-situ-Dekontamination in der stationären wie auch mobilen Frischluftversorgung eignen, welche Art von Filterbelegung (d.h. welche Erreger oder Chemikalien) hiermit geeignet entfernt werden kann und ob und wie die Technologien potentiell auf die vom Filter geschützten Räume wirken können (z.B. durch UV-induzierte Ozonbildung). Zu diesem Zweck sollen die Technologien an repräsentativen Filtermaterialien mithilfe biologischer und chemischer Kampfstoff-Simulanzien getestet werden.
Förderung: FORTE, FORTE – Kooperative F&E-Projekte KFE 2023
Projektkonsortium:
Lead: FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH
OFI Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik